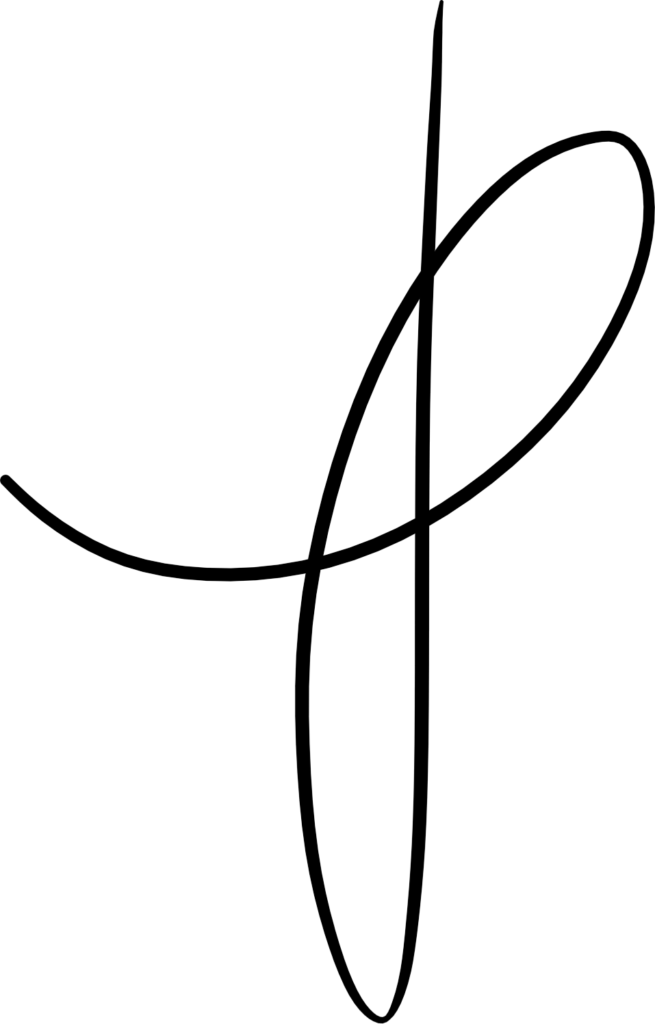… aber wer mich kennt und mag, wird vielleicht die ein oder andere Situation entdecken, in der er oder sie auch anwesend war.
Gott, es ging so schnell! Das erste Viertel meines Lebens ist vorbei. Blöderweise ist es das spannendste von allen. Das, in dem am meisten passiert, weil es halt einfach das erste Viertel ist.
Gut, heiraten und Kinder gebären kommt noch, aber sonst warten eigentlich nur noch eher negative Großereignisse auf mich (Falten, graues Haupthaar, Hängetitten, Cellu im fortgeschrittenen Stadium, Sehschwäche, dann auch irgendwann Gehschwäche) und irgendwann bin ich tot und ich wette, in den Minuten davor werde ich vor allem an die ersten 25 Jahre denken.
(Wenn wir schon beim Sterben sind, möchte ich nochmals darauf bestehen, dass ich eingeäschert werden will, damit euch da später mal kein Fehler unterläuft und ihr mich exhumieren müsst, klar?)
Ich kam ziemlich hässlich auf die Welt, berichtete man mir. „Meine Arbeitskollegin meinte ‚Das wird schon noch’, als sie mich im Krankenhaus besuchte“, sagt meine Mama, wenn ich in meinem rosanen Fotoalbum (das erste und letzte) das Bild suche, auf dem ich aussehe wie ein Klitschko nach dem Kampf (heute hat sich das natürlich alles verwachsen ;)).
So mit 5 oder 6 sah ich dann aus wie Annika aus Pippi Langstrumpf (modischer Bob mit dickem Pony) und da setzt meine Erinnerung ein.
Ich werde in den letzten Minuten meines vierten Vierteljahrhunderts (man muss schon ein bisschen optimistisch sein) an den lustigen Nachmittag denken, an dem meine kleine Schwester (ich glaube, die noch kleinere hatte noch Eizellenformat) unseren grünen Daumen entdeckt haben. Da kam grad der grüne Punkt raus und wir gingen von Haus zu Haus, klingelten und fragten die Leute, ob sie was für die Umwelt tun möchten. „Was für die Umwelt tun“ bedeutete, dass sie uns ihren Müll mit dem grünen Punkt geben. Unsere Mama war hoch begeistert, als wir ziemlich stolz mit zwei großen Müllsäcken voll Umwelt vor der Tür standen. Sie rief damals direkt bei Oma an und fragte panisch: „Hast du noch Platz in deiner Tonne?“
Ich werde in diesen Minuten an die erste Klasse denken. Ich weiß noch genau, wie ich mich in der Grundschule in den Papierkorb gesetzt habe, um Aufmerksamkeit zu erregen und meine Schulkameraden zu erheitern.
Damals hatte ich gehörige Probleme mit Textaufgaben. Mein Papa erfand solange neue Aufgaben auf Schreibmaschinenpapier (grün/weiß-gestreift), bis ich irgendwann aus purer Routine den richtigen Lösungsweg erahnte (mit Verstehen hatte das wenig zu tun, eher mit Versehen): Julia fährt mit dem Traktor von A nach B und braucht 10 Minuten und 2 Liter Benzin. Wie viel Liter Benzin braucht Julia, wenn sie von A nach C fährt und dafür 30 Minuten braucht? Äh, ja. Ich hatte keinen blassen Schimmer. Beim Nicht-Lösen dieser Textaufgaben erreichte mich eine leise Vorahnung, dass Mathe niemals meine Stärke werden würde.
Meine Mama erzählt heute noch mit Begeisterung die Geschichte mit den kleinen Handtüchern (es gab doch mal so gepresste kleine Handtücher mit kindlichen Motiven wie Winnie Pooh, die sich entfalteten, wenn man sie ins Wasser legte). Da hatte ich ein Sonderangebot gesehen, 1 für 2 Euro, 3 für 7 Euro. Top!
Und ich weiß noch genau, wie ich Streberin (lang her) in der fünften Klasse in Erdkunde bei Frau Bald meine erste 5 bekam. Mein Papa musste Schwerstarbeit leisten (geografisch und psychologisch), um mich wieder halbwegs auf Spur zu kriegen. Ich war damals seelisch gebeutelt und zweifelte stark an mir selbst. Ich hatte einfach noch nicht verstanden, dass man ab jetzt was lernen muss, wenn man weiter 1en schreiben will.
Also, ich hatte dann noch mehrere 5en und in Deutsch sogar mal eine 6, weil ich das Passiv nicht „gelernt“ hatte. Meine Lehrerin Frau Donth fragte mich damals beim Herausgeben der Ex, wer das geschrieben hat, weil von mir könne es ja nicht sein. Meine kleinlaute Antwort lautete: „Doch, war ich. Hab’s nicht gelernt. In Englisch hab ich’s gelernt, da hab ich gestern ne 1 rausgekriegt.“ Diese weiteren 5en und die 6 schmerzen aber nicht mehr so, die waren Hauptsächlich in Mathe, und da wusste ich ja schon, dass das ein Quatsch-Fach ist und ich das beim Schreiben später eh nicht brauchen kann.
Achja, nicht unerwähnt sollte auch meine Spick-Sechs in Französisch bei Herrn Pöllath bleiben. Die bekam ich in Klasse 11, weil ich einen alten Spicker aus dem Vorjahr noch im Deckel meiner Stiftedose pappen hatte. Es trug sich folgendermaßen zu: Herr Pöllath machte eine Runde, ich klappte vorsichtshalber das Ding zu. Er kam her, keifte: „Mach mal auf!“ und ich tat es. Er grapschte sich die Dose, schielte hinein (oh ja, Schielen konnte er!) und stellte sie wieder auf den Tisch. Ich machte die Box wieder zu und atmete leise auf. Dann geiferte er: „Mach mal nochmal auf!“ und dann fuhr er aus der Haut und gab mir eine Spick-Sechs. Ich sach mal so: Lieber Herr Schiel-Pöllath, Sie haben den Zettel sechs Mal übersehen. Ganz okaye Bilanz.
Gymnasium also. Ziel: Abitur. Meine Englischlehrerin Frau Kroner-Kunze sagte bei einem Elternabend in der 5. Klasse zu meiner Mama: „Ja ja, die macht schon das Abitur, wenn ihr kein Kerl in die Quere kommt.“ Dass mir keiner in die Quere kam, kann man jetzt nicht sagen, aber es war keiner dabei, der mir total die Birne vernebelt hat, so dass ich nicht den Durchmarsch bis zum Abi hätte meistern können.
Da waren allerdings so ein paar gute Vorsätze … als wir das gebührende Alter erreicht hatten (,oder halt volljährige Personen gefunden hatten, deren Ausweis wir uns stets leihen konnten), besuchten wir immer mal wieder donnerstags einen kleinen Club in Nürnberg. Ein paar Wochen vor den Abiprüfungen beschlossen wir, diese Besuche ab jetzt sein zu lassen, weil wir uns voll und ganz aufs Lernen konzentrieren wollten.
Ende vom Lied: Wir waren ab da wirklich jeden einzelnen Donnerstag in diesem Club und unsere Abischnitte verschlechterten sich durchschnittlich höchstens um 0,5.
Irgendwann war es dann bestanden, das Abi, und wir schusterten eine großartige Abizeitung zusammen: „Götter verlassen den Olymp“ stand auf dem Titel und wir hüllten uns für das Foto in weiße Bettlaken und drapierten Trauben und Weinflaschen um uns herum. Auf der Rückseite der Zeitung fehlten wir auf dem Bild – leere Flaschen, ein paar Betttücher und Traubenreste zierten es.
Wir waren dann mal weg. Sternförmig auseinander – eine mutige Choreografie. Jeder bekam ein Ruder und dann hieß es: So, jetzt paddelt mal. Ich hatte beschlossen, nach Regensburg zu paddeln, um dort zu studieren. Was, war erst mal egal, Hauptsache Regensburg, weil es da so schön war, wie ich während des Stopps bei einer früheren Radtour (Stoppdauer: circa eine Stunde) flott festgestellt hatte.
Kunst und Deutsch für Realschule hatte ich mir überlegt, meine Mama jauchzte, mein Herz heulte. Eigentlich wollte ich nicht Lehrerin werden, auch wenn ich das in der ersten Klasse überzeugt (d.h. mit Füller, nicht mit Bleistift) in alle Poesiealben geschrieben hatte. Glücklicherweise entschied sich die Uni Regensburg dann kurzfristig dazu, die Medienwissenschaften in ihr Repertoire aufzunehmen, ohne N.C. (weil erstes Semester) – somit war mein Studienplatz geritzt.
Regensburg war wirklich die perfekte Stadt, um auf die (eigenen) Beine zu kommen. Nicht zu groß, nicht zu klein, genau richtig viel los, dass einem nicht langweilig wird, genau richtig weit weg von daheim, dass man auf keinen Fall pendeln kann. Vier Jahre lang war ich da, lebte in einer WG mit einer Freundin, in einer WG mit drei Jungs („Heute hat der Aschenbecher auf dem Küchenfensterbrett gebrannt, ich hab’s auch nur bemerkt, weil oben Rauch am Fenster vorbeizog. Willst auch ein Bier?“), in einer WG in London und dann in trauter Zweisamkeit.
Während dieser Studienzeit stellte ich die Weichen für jetzt. Ich machte Praktikum um Praktikum in „den Medien“, bis ich wusste, dass ich schreiben will, online. Damit war es dann besiegelt. ES = Zukunft = trotzdem relativ unbekannt. „IWM war ne scheiß Idee!“, dachte ich zwischendrin oft. IWM heißt „Irgendwas mit Medien“ und ist die tolle Antwort, die junge Menschen geben, wenn sie sagen wollen, dass sie was Cooles werden wollen und halt jetzt mal so was studieren.
Ich hab diese Antwort auch immer gegeben, wenn mein Onkel Manfred gefragt hat, was ich eigentlich machen will, weil es mit diesem Studium ja dann eh keine Jobs gibt. Wenn er dann altklug antwortete, dass ich doch lieber Lehrerin werden solle, „weil man da so viel Freizeit und so lange Ferien hat“, hätte ich ihm jedes Mal am liebsten die Augen ausgekratzt.
Ich wusste, DASS es was wird, aber ich wusste noch nicht, WAS GENAU es wird (wie beim Kinderkriegen halt). Meine Standardantwort war dann: „Ich will aber nicht jedes Jahr dasselbe machen, außerdem wäre ich viel zu ungeduldig mit den Rotzgören. ICH. WILL. SCHREIBEN!“
Ich kann es kaum erwarten, meinem Onkel am Sonntag, wenn wir uns zum Geburtstagskaffee sehen, auf seine beknackte Frage folgende Antwort zu geben: „Ich mache genau das, was ich immer machen wollte: Mein Hobby ist mein Beruf geworden. Journalistin ist der tollste Job der Welt und ich bin zu 100 Prozent am richtigen Fleck, tschüss, danke.“
Ich bin 25 Jahre alt und fühle mich irgendwie angekommen. So, als hätten sich alle Teile meines Lebens schön langsam richtig zusammengefügt. Woran erkenne ich das? Ich bin ausgewachsen, 1,78 ist also final mein Stabmaß für die nächsten Jahre.
Ich akzeptiere mein Gewicht (irgendwann schnallt man halt, dass man sich zwischen Busen (leider in Kombi mit Arsch) und kein Arsch (leider in Kombi mit kein Busen) entscheiden muss), ich färbe mir nicht mehr die Haare, ich knabbere nicht mehr an meinen Fingernägeln. Ich kaufe Schuhe und Taschen aus Leder, bestelle leider trotzdem noch viel Schrott bei Zara, und gebe zu viel Geld für fancy Gummistiefel für Festivals aus.
Ich fange mit Traditionen an (Festival muss jedes Jahr sein, PJP-Abende müssen in regelmäßigen Abständen stattfinden, ich backe). Ich habe mit dem Zweifeln aufgehört (irgendwie ist das schon alles richtig gelaufen) und mit dem Glauben angefangen (irgendwie ist das schon alles richtig gelaufen). Eine Freundin bescheinigte mir kürzlich offiziell den nächsten Reifegrad und mit dem beende ich jetzt diese Zeilen über längst vergangene Zeiten, die nie wieder passieren werden.
Was lernen wir daraus? Es macht keinen Sinn, beschissen drauf zu sein. Daran will man sich am Ende nämlich nicht erinnern. Habt Spaß, Leute, das ist der einzige Sinn des Lebens (klingt oberflächlich, aber es stimmt. Ja ja, ein bisschen Gutes tun gehört auch dazu, aber selbst das zählt am Ende in die Spaß-Kategorie, weil es anderen ein gutes Gefühl gibt und das eigene Herz wärmt.)
My Love, my family, my friends, my enemies: DANKE an euch alle, dass ihr die ersten 25 Jahre Julia mitgemacht habt, ich hoffe, ihr bleibt bei der Stange (die kurvige)! Das Leben ist ein großes Fest, durchzogen von regelmäßigen Katern zwar, aber trotzdem wunderbar.